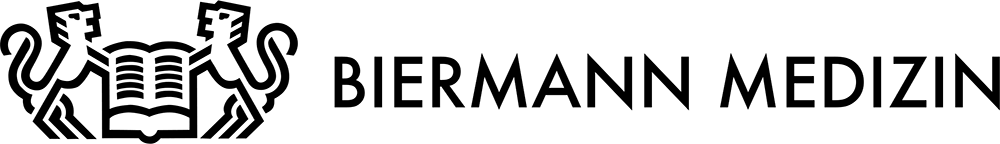Kratom wird zunehmend zur Selbstmedikation genutzt, obwohl die Sicherheit und Wirksamkeit der Substanz nicht ausreichend erforscht sind. Eine aktuelle Studie liefert neue Einblicke in den Zusammenhang zwischen Kratomkonsum und Schmerzbewältigung.
Kratom, auch pflanzliches Speed genannt, wird aus Pflanzenteilen des Kratombaumes (Mitragyna speciosa) gewonnen. Es enthält unter anderem das Alkaloid Mitragynin, dass als atypisches Opioid an µ‑Opioidrezeptoren bindet. Neben einer sedierenden und analgetischen Wirkung wird dem Mittel in niedrigeren Dosierungen auch ein aufputschender Effekt nachgesagt. Im Dezember 2024 warnte die Deutsche Verbraucherzentrale im Zusammenhang mit der Droge vor einem „erheblichen Risiko“: Kratompulver könne abhängig machen und zu gefährlichen Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen führen.
In vielen Ländern weltweit gehört Kratom zu den zu kontrollierenden Substanzen (ähnlich Drogen) und ist kein legales Nahrungsergänzungsmittel, so auch in Deutschland. Auch gibt es hierzulande keine Arzneimittel oder Medizinprodukte mit Kratom. Dennoch wird es in zunehmendem Maße zur Selbstbehandlung von Schmerzen eingesetzt, obwohl seine Wirksamkeit und Sicherheit nur begrenzt erforscht sind.
So zeigt eine aktuelle Erhebung unter 395 Kratomkonsumenten in den USA, dass fast die Hälfte (49,1%) die Kriterien für chronische Schmerzen erfüllte. Dabei erfolgte die Rekrutierung der Teilnehmer ausschließlich auf Grundlage ihres Kratomkonsums und nicht danach, ob sie Kratom zur Schmerzbehandlung verwendeten, wie die Autoren der im „Journal of Pain“ publizierten Studie erläutern. Ihnen zufolge berichtete die Mehrheit der Befragten (69,2%) von Schwierigkeiten bei der Erlangung einer angemessenen Schmerzbehandlung, und die meisten gaben an, dass diese Schwierigkeiten ihre Entscheidung, Kratom auszuprobieren, beeinflusst haben.
Viele der schmerzgeplagten Kratomkonsumenten berichteten außerdem über eine erhebliche Schmerzlinderung und eine hohe Wirksamkeit von Kratom bei der Schmerzbehandlung. Dabei äußerten die meisten Teilnehmer keine Bedenken bzgl. eines übermäßigen Gebrauchs oder erheblicher Nebenwirkungen.
Zusätzlich zur Ausgangsbefragung nahmen 357 der Kratomkonsumenten an einem 15-tägigen Ecological Momentary Assessment teil. Die Auswertung dieser alltagsnahen Datenerhebung ergab, dass unabhängig vom Status der chronischen Schmerzen die Schmerzlinderung die am häufigsten angegebene Hauptmotivation für den täglichen Kratomkonsum war. Es bestand jedoch kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem täglichen Schmerzniveau und der Häufigkeit des Kratomkonsums. Auch gab es keinen Unterschied zwischen dem täglichen Kratomkonsum von Personen mit und ohne chronische Schmerzen. Allerdings war kürzlicher Kratomkonsum mit niedrigeren aktuellen Schmerzwerten verbunden.
Stärkere subjektive Wirkungen von Kratom wurden mit geringeren Schmerzen in Verbindung gebracht. Dieser Effekt wurde signifikant durch den Status der chronischen Schmerzen beeinflusst: Personen mit chronischen Schmerzen zeigten einen stärkeren Zusammenhang zwischen der subjektiven Wirkung von Kratom und der Schmerzlinderung.
Fazit
Die Autoren betonen: „Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer systematischen, rigorosen Forschung über die langfristigen Auswirkungen, die Wirksamkeit und die Sicherheit von Kratom bei der Schmerzbehandlung, um eine fundierte klinische Praxis und eine entsprechende Regulierungspolitik zu ermöglichen.“ (ah)
Autoren: Mun CJ et al.
Korrespondenz: Kirsten E. Smith; ksmit398@jh.edu
Studie: Kratom (Mitragyna speciosa) use for self-management of pain: Insights from cross-sectional and ecological momentary assessment data
Quelle: J Pain 2024;26:104726.
Web: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2024.104726